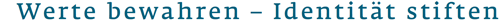Erhalt & Pflege
Damit Schäden gar nicht erst entstehen: Eine wichtige Aufgabe der Abteilung für Bau- & Kunstpflege ist die Bauunterhaltung. Mit kontinuierlicher Pflege der Bausubstanz überdauern Denkmale Jahrhunderte. Es folgt eine Übersicht aktueller Projekte.
Änderung der historischen Bestuhlung in der Stiftskirche Fischbeck
Zeitraum: 2023-2024
Umfang: drei vordere Bankreihen durch flexible Bestuhlung ersetzt
Zuständige Klosterkammer: Planerin Katja Hennig und Bauleiter Frank Güsewelle mit kunsthistorischer Begleitung von Dr. Jörg Richter
Die vorhandenen Kirchenbänke sind Teil einer im 18. Jahrhundert vorgenommenen Neuausstattung. Das für eine angewachsene Bevölkerung konzipierte Gestühl war auf die 1710 geschaffene Kanzel ausgerichtet. Gravierend verändert wurde dies im Zuge einer Neugestaltung des Kirchenraumes 1903-04. Weitere Eingriffe erfolgten beim Einbau einer Bankheizung. Angesichts der Veränderungen im 20. Jahrhundert schien es aus denkmalpflegerischer Sicht vertretbar, die Bestuhlung nun zugunsten gegenwärtiger Nutzungen erneut zu ändern.
Von Seiten des Stiftes Fischbeck und der Kirchengemeinde bestand der Wunsch, die Bestuhlung im Langhaus der Stiftskirche an aktuelle Bedürfnisse anzupassen.
Nach denkmalpflegerischer Abwägung wurden die ersten vier Bankreihen im Mittelschiff entfernt, um vor den zum Chor führenden Stufen Raum für die Feier von Gottesdiensten zu schaffen. An die Stelle der Kirchenbänke traten drei Reihen von Stühlen, deren Anordnung sich je nach Nutzung verändern lässt.
Revision des Kunstinventars in der Klosterkirche Nikolausberg
Zeitraum: 2024
Kosten: rund 4.300 Euro
Umfang: Digitalisierung und Vervollständigung der Daten sowie fotografische Dokumentation des Kunstinventars
Zuständiger der Klosterkammer: Kunsthistoriker Dr. Jörg Richter, Abteilung Bau- und Kunstpflege
Das Kunstinventar in den Kirchen des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds, der größten der von der Klosterkammer verwalteten Stiftungen, ist 1988 auf Karteikarten erfasst worden. Viele Grunddaten fehlen. Daher werden die Kirchen schrittweise durchgegangen und das schützenswerte kulturhistorische Inventar in der digitalen Datenbank PicAr erfasst.
Die Kirche auf dem Nikolausberg ist vor 1160 für Augustiner-Chorfrauen gegründet worden. Deren Konvent übersiedelte später in das nahegelegene Weende. Besondere Bedeutung erhielt die Kirche Nikolausberg, als sie im 14. Jahrhundert zum Ziel einer Wallfahrt wurde. Pilger wandten sich hier an den als Wundertäter bekannten heiligen Nikolaus.
Trotz starker Verluste in Folge der Reformation beherbergt die Kirche Nikolausberg ein bemerkenswertes Kunstinventar, darunter die im Mittelalter verehrte Skulptur des heiligen Nikolaus und zwei Flügelaltäre. Neu erfasst wurde unter anderem die aus dem frühen 16. Jahrhundert stammende Ausstattung der Sakristei, die aus einem Altar, einem Wandschrank und einem Waschbecken (Piscina) samt Handtuchhalter besteht.
Nach der Reinigung durch Restauratorinnen wurde das Kunstinventar durch Ulrich Loeper professionell fotografiert.
Sanierung und Erweiterung der Orgel in der Basilika St. Godehard in Hildesheim
Zeitraum: 2021-2022
Zuständige der Klosterkammer: Baudezernent Dr. Tim Wameling, Bauleiter Arno Braukmüller, Abteilung Bau- und Kunstpflege
Die historische deutschromantische Orgel in der Basilika St. Godehard bildet mit ihrem Prospekt von 1864 eine stilistische Einheit mit der übrigen Raumausstattung aus den Jahren 1861 bis 1864. Das Instrument selber stammt aus dem Jahr 1912 von der Firma Furtwängler und Hammer und beinhaltet Material der Stahlhuth-Orgel von 1864. Das Instrument erfuhr ab 1946 starke Veränderungen. Zwar war das romantische Instrument noch zu erahnen, zuletzt jedoch klanglich unstimmig, technisch unzuverlässig und damit für Liturgie und Konzerte nicht mehr akzeptabel. Die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten wurden nach einer intensiven Vorbereitungszeit in den Jahren 2021 bis 2022 durch die Orgelbaufirma E. Hammer sorgfältig und fachgerecht umgesetzt. Die hierfür notwendigen Mittel stellten die Klosterkammer, die Pfarrgemeinde und Förderer bereit.
Hier finden Sie einen Film zur Orgelsanierung in St. Godehard.
-
Über das neue Treppenhaus samt Aufzug sind nun alle Geschosse des Konventflügels und auch des Abteiflügels mit den dortigen repräsentativen Räumen barrierefrei erreichbar. Foto: Micha Neugebauer
-
Blick aus dem Flur ins neue Treppenhaus und weiter in den Abteiflügel. Foto: Micha Neugebauer
-
Die eingestellten Kuben in Leichtbauweise erhöhen die Nutzbarkeit des Klostergebäudes. Foto: Micha Neugebauer
-
Ein geschickt geplantes Miteinander von Alt und Neu ermöglicht den Erhalt bauzeitlicher Ausstattung und die Erfüllung baurechtlicher Anforderungen. Foto: Micha Neugebauer
Instandsetzung des Konventflügels der Klosteranlage Lamspringe für eine nachhaltige Nutzung
Zeitraum: 2019-2023
Kosten: rund 2,9 Millionen Euro
Zuständige der Klosterkammer: Für Entwurf und Bauleitung waren aus der Abteilung Bau- und Kunstpflege Christina Lippert, Katja Hennig, Tobias Lecher und Johannes Mädebach verantwortlich.
Weiterhin beteiligt waren:
Tragwerksplanung: IB Götz & Ilsemann, Hildesheim
Fachplanung Versorgungstechnik: IB Lübbe + Spiess, Hannover
Fachplanung Elektrotechnik: ap elektroanlagen Planung GmbH, Hannover
In den Jahren um 1730 bis 1740 wurde auf dem Gelände des Klosters Lamspringe ein Wohntrakt für Benediktiner errichtet. Mit Auflösung des Klosters 1803 verlor der Bau seine ursprüngliche Funktion. Im Inneren folgten Umstrukturierungen teils für Wohnungen, teils für Amtsräume.
Die Klosterkammer Hannover steht vor der Aufgabe, die barocke Klosteranlage denkmalgerecht zu erhalten und zeitgemäße Nutzungen zu ermöglichen. In jüngster Zeit wurde der östliche Teil des Konventflügels instandgesetzt. Das Innere wurde für eine Nutzung durch die Gemeindeverwaltung Lamspringe umgebaut. Dieser Funktion kam die im 18. Jahrhundert angelegte modulare Struktur der Räume und Fassaden entgegen. Jüngere Trennwände wurden rückgebaut, um die ursprüngliche Raumfolge wieder freizulegen. Vor allem die weiten Flure des Klosters sind nun wieder erlebbar. Eingestellte Kuben in Leichtbauweise ermöglichen hier eine Büronutzung, die jederzeit reversibel ist. Ein neuer Zugang, Aufzug und Treppenhaus erschließen alle Geschoßebenen barrierefrei.
-
Blick auf den Haupteingang der Klosterkirche Marienwerder. Foto: Micha Neugebauer
-
Besser sichtbar nach der Sanierung: die ablesbaren historischen Strukturen auf der nördlichen Querhausfassade. Foto: Micha Neugebauer
-
Detailaufnahme der Anbindung des Blitzschutzes. Foto: Micha Neugebauer
-
Diese fotogrammetrische Aufnahme, zusammengesetzt aus einzelnen Fotos, dokumentiert den Zustand der Fassade ohne Putz und hilft, diesen bauhistorisch zu bewerten. Grafik: Formwerk3D
-
Die Ostansicht gewährt den Blick auf Chor und Apsis. Foto: Micha Neugebauer
Fassadensanierung der Klosterkirche Marienwerder
Zeitraum: 2022
Kosten: rund 242.000 Euro
Umfang: Instandsetzung der Fassaden mit einer Erneuerung des Putzes samt Anstrich
Zuständige der Klosterkammer: Baudezernent Dr. Tim Wameling, Bauleitung Claudia Bartels, Restaurator Johannes Mädebach, Abteilung Bau- und Kunstpflege
Die um 1200 im romanischen Stil als dreischiffige Basilika errichtete Klosterkirche ist der älteste stehende Kirchenbau Hannovers. Sie wird vom Konvent des Klosters und von der Kirchengemeinde Marienwerder genutzt.
Die Fassade der Klosterkirche wies altersbedingte Schäden auf. Die letzte umfassende Fassadensanierung wurde in den frühen 1970er-Jahren ausgeführt. Aufgrund der hohen Schädigung des vorhandenen Putzes musste dieser vollflächig abgenommen werden. Die unverputzte Fassade bot die Chance, die nun sichtbaren Spuren im Mauerwerk dank fotogrammetrischer Aufnahmen zu dokumentieren und bauhistorisch zu bewerten. Die Erkenntnisse wurden in das Gestaltungskonzept einbezogen.
Das Schadensbild zeigte vereinzelt größere Mauerwerksbereiche und Einzelsteine, die aufgrund von Zweitverwendung und Brandschäden nicht mehr tragfähig waren – sie mussten ersetzt und mittels aufwendiger Abfangmaßnahmen erneuert werden. Die baukonstruktiv unzureichende Befestigung der Ortgangabdeckungen und Konsolensteine aus Sandstein erforderten eine Lagesicherung durch Verankerung der großformatigen Platten mittels Edelstahlanker. Ebenso mussten einige Traufgesimssteine ersetzt und durch Verankerungen vor Herabfallen gesichert werden.
Abschließend wurden sämtliche Fensterrahmen malermäßig überarbeitet, die Klosterkirche mit einem dünn aufgetragenen Kalkputz neu verputzt und mit einer leicht abgetönten Kalkfarbe gestrichen.
-
Bohrarbeiten während der Ausführungsphase in der Stiftskirche. Foto: Micha Neugebauer
-
Ungewohnte Blickwinkel vom Gerüst während der Bauphase auf den Hauptaltar. Foto: Micha Neugebauer
-
Neues Lichtkonzept im Mittelschiff nach der Sanierung der Stiftskirche. Foto: Oliver Gruba, Klosterkammer
-
Blick auf Altar und Kanzel nach der Instandsetzung. Foto: Ulrich Loeper
Instandsetzung des Innenraums der Stiftskirche Wunstorf
Zeitraum: 2020-2021
Kosten: rund 1,8 Millionen Euro
Umfang: Instandsetzung des Innenraums inklusive umfangreicher Voruntersuchungen und eine statische Sicherung des Vierungsgewölbes
Zuständige der Klosterkammer: Baudezernent Dr. Tim Wameling, Bauleitung Oliver Gruba, Abteilung Bau- und Kunstpflege
Die Kirche des im Jahr 871 erstmals erwähnten Damenstiftes Wunstorf konnte 2021 auf ein 1150-jähriges Bestehen zurückblicken. Der heutige Bau ist im Wesentlichen eine Gewölbebasilika des 12. Jahrhunderts. Die letzte Instandsetzung des Innenraums wurde in den Jahren 1967 bis 1968 vorgenommen; dabei wurde die Warmluftheizung eingebaut und auch ein neuer Vierungsaltar geschaffen. Nach mehr als 50 Jahren war es an der Zeit, den Innenraum der Stiftskirche zum Jubiläum 2021 erneut zu sanieren.
Insbesondere bedurften die stark verschmutzten Oberflächen der Wände und der Kunstwerke einer Bearbeitung. Die Heizung und die gesamte Elektrik mussten erneuert werden. Die Finanzierung erfolgte hauptsächlich aus Mitteln des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds, während die Stiftskirchengemeinde in die Beleuchtung und in die akustische Anlage investierte.
Ein 3D-Scanner erfasste zunächst das Gebäude und generierte daraus Pläne und ein virtuelles 3D-Modell, das eine Art „Röntgenblick“ durch das Gebäude ermöglichte. Einen Schwerpunkt bildeten die Untersuchungen zum Zustand und zur Farbigkeit der Wände und Gewölbe. Anschließend wurden Musterflächen für das künftige Erscheinungsbild angelegt. Eine aufwendige statische Sicherung des Vierungsgewölbes, um die das Projekt erweitert werden musste, führte zu einer Verlängerung der Bauzeit. Ab Weihnachten 2021 konnte die Stiftskirche wieder genutzt werden.