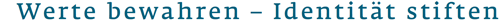02.09.2025
50 Interessierte erkundeten das Kloster Walsrode während Baustellen-Führungen
Einblick in die energetische Sanierung und Gemälde-Restaurierung

Bauleiter Henrik Boldt (links) schilderte, wie und wo Lehmputz und Lehmwickel (mittig im Bild zu sehen) verbaut worden sind. Foto: Harald Koch
In drei Gruppen führten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Bau- und Kunstpflege der Klosterkammer am 23. August 2025 Gäste durch einzelne Räume des Klosters Walsrode.
Im Sommer 2023 haben die umfangreichen Bauarbeiten der Klosterkammer auf dem Gelände des Klosters begonnen, sie bedeuten einen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Die Arbeiten umfassen die Grundinstandsetzung von vier Wohnungen sowie die Erneuerung der elektrischen Anlagen. Drei Wohnungen für Klosterdamen und eine für Pilgerinnen und Pilger werden an aktuelle Bedürfnisse angepasst. Mit einer Innendämmung und neuen Innenfenstern sinkt der Energiebedarf, um so den CO2-Ausstoß zu reduzieren und zusätzlich mehr Behaglichkeit für die Bewohnerinnen und Gäste des Klosters zu erreichen.
Um 11 Uhr startete die erste von drei Führungen mit einer Einführung zur Klosteranlage sowie zum Zusammenhang mit der Klosterkammer Hannover, die den Bauunterhalt der sechs Lüneburger Klöster seit 1963 gewährleistet, zu dem auch das Kloster Walsrode gehört. Heute wird es als evangelisches Damenstift von der Äbtissin Dr. Eva von Westerholt geführt. Gegründet wurde das Kloster im 10. Jahrhundert als Kanonissenstift und ist damit das älteste im ehemaligem Fürstentum Lüneburg. Erhalten ist in weiten Teilen die Bausubstanz aus dem Barock.
Bau-Dezernentin Christina Lippert und Bauleiter Henrik Boldt, beide in der Abteilung für Bau- und Kunstpflege der Klosterkammer tätig, gaben einen Überblick über die aktuellen Arbeiten im Langen Haus. Dort werden drei Wohnungen für Konventualinnen sowie eine für Pilgerinnen und Pilger grundlegend renoviert. „Ausgangspunkt war die notwendige Erneuerung der elektrischen Anlagen. Dafür mussten Wände und Decken geöffnet, Bäder und Küchen erneuert werden. In dem Zuge haben wir die energetischen Eigenschaften des Gebäudes ertüchtigt, zum Beispiel im Innenbereich der Wohnungen Korkdämmlehm verbaut und die Decke über dem Erdgeschoss gedämmt. Ziel ist es, den Energiebedarf zu senken“, erläuterte Christina Lippert. In den Wohnungen konnten die Gäste mit Hilfe von Plänen, großformatigen Fotos und Beispielen von verbauten Materialen wichtige Grundsätze des Denkmalschutzes nachvollziehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle Arbeiten wieder rückgängig zu machen sein müssen, ohne die historische Bausubstanz zu schädigen. Henrik Boldt schilderte einen weiteren Grundsatz der Denkmalpflege: „Wir haben ökologische Baustoffe verwendet, die dem historischen Material möglichst ähnlich sind. In den Decken sind zum Beispiel Lehmwickel verbaut. Dabei handelt es sich um Hölzer, die mit Stroh und Lehm umwickelt sind. Lehmputz ist an den Innendecken sowie an den Außenwänden zum Einsatz gekommen.“

Restauratorin Kirsten Schröder (Mitte) erläuterte in der Kapelle die Restaurierung eines Äbtissinnen-Portraits. Foto: Harald Koch
Den Abschluss der Rundgänge bildete jeweils eine Station in der Klosterkapelle. Dort erklärte Klosterkammer-Restauratorin Kirsten Schröder, wie sie das Portrait einer der ehemaligen Klostervorsteherinnen, der 1737 verstorbenen Äbtissin von Stolzenberg, restauriert hat. „Aufgrund der Sonneneinstrahlung war die Deckschicht des Gemäldes auskristallisiert, deshalb habe ich es genauer untersucht. Dabei kam heraus, dass es in den 1960er-Jahren restauriert und unter anderem mit einer Kunststoff-Deckschicht überzogen worden war, die sich chemisch verändert und zu dem Schadensbild geführt hat“, schildert Kirsten Schröder. Damit ähnliche Schäden bei weiteren Gemälden gar nicht erst auftreten, hat sie zusammen mit Bauleiter Henrik Boldt eine Folie für die Fenster der Kapelle ausgewählt, die einen Teil der Sonneneinstrahlung herausfiltert und so einen Schutz für die Kunstgegenstände bietet. Das ist ein Beispiel, wie wichtig die Abstimmung baulicher Maßnahmen und der Einsatz der Restauratorinnen und Restauratoren der hauseigenen Werkstätten ist, um die insgesamt rund 700 Baudenkmale im Verwaltungsbereich der Klosterkammer mit ihrer vielfältigen kunsthistorischen Ausstattung dauerhaft zu erhalten. (lah)

Waren gemeinsam im Einsatz (v. l.): Restauratorin Kirsten Schröder, Bauleiter Henrik Boldt, Äbtissin Dr. Eva von Westerholt und Bau-Dezernentin Christina Lippert. Foto: Harald Koch